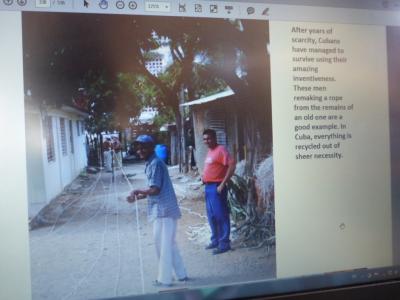Ausgeschlafen, frisch und munter machen wir uns am 14. Juni auf nach Norfolk, um unser neues Cruising-Permit zu erwerben.
Das ist die ominöse Erlaubnis, die es dem ausländischen Bootsfahrer gestattet, innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens, amerikanischen Grund und Boden zu betreten, ohne sich bei jeder Anlandung (für jeweils 19USD) neu an- und abmelden zu müssen. Sie ist unter Seglern heiß diskutiert und die Tipps, wo man sie am besten erhält oder verlängern lassen kann, werden unter der Hand weitergegeben.
Wir sind schon mehr als drei Wochen überfällig, da unsere Lizenz am 24. Mai abgelaufen ist, haben uns in St. Augustine vorschriftsmäßig abgemeldet und als nächste Anlandung Norfolk angegeben. „Oh,Oh“…hört man nun vom aufmerksamen Leser… „und was ist mit dem Betreten von Cumberland und Jekyll-Island“???? Hm…Niemand hat’s bemerkt.
Aber unsere fleißigen Scouts, die Obelixens, haben ja bereits DIE Antragsstelle gefunden. Es ist der Zoll in Norfolk.
Ein freundlich dreinschauender, dunkelhäutiger Beamter dirigiert uns augenzwinkernd beim Ausfüllen der Antragsformulare. Kopierergeratter, Stempelgräusche, ein paar Unterschriften, 19USD (ABGEZÄHLT!!!) und wir verlassen mit dem begehrten „Cruising-Permit das Gebäude. Toll! Das muss begossen werden.

Da bietet sich doch nichts mehr an, als die Dachterrasse des Hilton direkt gegenüber.

„Ein Prost auf Euch, liebe Brigitte, lieber Frank!“… mit Ferrari-Sekt
Norfolk ist der größte Marine Stützpunkt an der Atlantikküste der USA.

Die USS Wisconsin

Ein kleiner Rundgang durch die am Wasser liegenden Bezirke der Stadt zeigt, dass Wohnen, Leben und Arbeiten größtenteils von der Marine geprägt sind.
Im – als Park angelegten Uferbereich – befinden sich neben dem „Nauticus“ – National Maritime Center und dem Schlachtschiff „USS Wisconsin“ zahlreiche Dokumente, Skulpturen, Gedenktafeln und Erinnerungen in vielgestaltiger Form an die Gefallenen diverser Kriege.
Eine Gedenkstätte geht sehr unter die Haut. Inmitten eines kargen, mit grauen Steinplatten belegten Platzes weht die Nationalflagge an hohem Mast;

auf dem Boden „herumfliegende“ dünne Kupferplatten mit aufgebogenen Ecken symbolisieren die Briefe von Kriegsgefallenen an ihre Lieben…
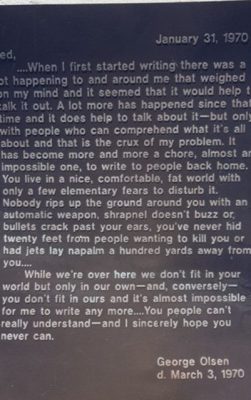
Wie lose Blätter – vom Wind verweht…
 Segler vor dem Marinestützpunkt
Segler vor dem Marinestützpunkt
 …und überall: Meerjungfrauen….Hier vor dem Stadthafen
…und überall: Meerjungfrauen….Hier vor dem Stadthafen
 …aber auch in Vorgärten…
…aber auch in Vorgärten…
Am nächsten Tag geht’s weiter nach Deltaville, wo Frank und Brigitte bereits auf uns warten. Es gibt ein fröhliches Wiedersehen mit Erdbeerbowle und viel Erzählstoff.


Die Beiden sind – mit einer Unterbrechung von 14 Tagen bei ihrer Tochter Jenny in Kanada – seit dem 11. April hier und kennen Deltaville wie ihre Westentasche. Ein Fleckchen Erde oder Wasser, das – umgeben von Natur pur – Ruhe und Entspannung bietet.
Zehn Tage Deltaville wirken wie „Ferien auf Saltkrokan…“ Kiefernduft und Vogelgezwitscher am Morgen machen gute Laune und wecken das monatelang verschüttete Bedürfnis nach Frühsport. Im 25m langen Pool der Marina können wir uns austoben.
Alles hier ist äußerst kundenfreundlich und günstig. 50,- USD/Woche für den Dinghi-Anleger, ein Courtesy-Car, d.h. die KOSTENLOSE Benutzung eines Autos, um Besorgungen im Umkreis von 15Meilen machen zu können, des Schwimmbades, der Waschküche, der Grills… Einigermaßenes WiFi gibt’s auch gratis.
Ganz wichtig für Peter: Fernsehen in der Captains Lounge mit Übertragung der WM…
Nebenbei leeren wir unser „Paketdepot“ auf der Obelix, die freundlicherweise unsere hierher beorderten Ersatzteile entgegengenommen hat. Neue Werkzeuge kommen erstmals zum Einsatz, einige Ersatzteile und Neuanschaffungen werden eingebaut, für die neue Lichtmaschine muss allerdings noch die Halterung abgeändert, eine neue Keilriemenscheibe bestellt, sowie ein neuer Regler eingebaut werden.
In fröhlicher Gesellschaft von Obelixens schauen wir uns die nähere, seeehr ländliche Umgebung an, lassen uns im Museum von Gloucester ein wenig in die Geschichte dieser Kleinstadt einführen, machen Großeinkäufe und landen zu mehr oder eher weniger „kulinarischen“ Abstechern in diversen Dorfkneipen…
 Oft schaue ich auf weise (oder greise) Häupter, die sich theoretisch und praktisch mit Technik und Elektrik befassen.
Oft schaue ich auf weise (oder greise) Häupter, die sich theoretisch und praktisch mit Technik und Elektrik befassen.
Hier beim Zerlegen des ehemals Allerheiligsten der Navigation, des Furuno-Computers… ein exclusives, wunderschönes Stück Schrott, dem die Spätfolgen des Blitzes von Teneriffa letztendlich (und kaum sichtbar) den Todesstoß versetzten…
Ein ordentliches Donnerwetter beendet die erholsamen Tage in Deltaville. Während Peter das WM Spiel Schweden Deutschland sieht, fahre ich zum Einkaufen ins Örtchen. Als ich den Supermarkt verlasse, sieht die Welt um mich herum dunkellila aus. Blitze zucken, Donner grollt und dann ergießen sich die Regenmassen trommelnd aufs Autodach. Das schafft kein Scheibenwischer.
Das Ende vom Lied: Nach der Rückkehr zur PIA hat Deutschland 2:1 gegen Schweden gesiegt, im Dinghi haben sich ca. 100l Wasser gesammelt, die Polster im Cockpit sind triefend nass, die Betten auch.
Mit Frank und Brigitte treffen wir uns wieder in Solomons. Eine herrlich weite Bucht mit Sandstrand, hübschen Häusern und kleinen Bootsanlegestegen. Würzige Waldluft weht herüber….Ein stimmungsvoller Grillabend vor einem unheilvollen Tag…
Bereits um 7.50h gehen wir Ankerauf, da wir eventuell heute noch in Georgetown, am Sassafras River, am Nord-Ost-Ende der Chesapeake ankommen wollen. Hier wird die PIA von Oktober bis April an Land stehen und wir möchten uns
1. Die Marina ansehen, die weit und breit die einzige ist, die einen Travellift hat, der Katamarane mit unserer Breite herausheben kann und
2. die erforderlichen Schweißarbeiten an der Lichtmaschinenhalterung dort ausführen lassen.
Die ersten Stunden zeigen, dass wir bei dem Gegenwind und der Gegenströmung nicht segeln können, sondern 70sm Motorfahrt vor uns liegen.
Ab ca. 14.00h können wir die große Brücke erkennen, die Ost- und Westufer der Chesapeake Bay miteinander verbindet. Uns fällt ein, dass wir uns ja unmittelbar nach dem Verlassen eines Staates beim darauffolgenden anmelden müssen. Gestern haben wir Virginia verlassen, also sollten wir uns schleunigst in Maryland anmelden.
Wir finden die Telefonnummer der Behörde, werden in rasend schnell und nuschelig gesprochenem Englisch mit 10 Auswahlmöglichkeiten für entsprechende Informationen konfrontiert und verstehen nur die Hälfte.
Die Brücke rückt näher. Das Telefonieren wird auf später verschoben. Während Peter fährt, versuche ich – vom Cockpit aus – ein paar Fotos von dieser imposanten Brückenkonstruktion zu machen.
 Der westliche Teil der Brücke, der nach Annapolis führt…
Der westliche Teil der Brücke, der nach Annapolis führt…
 …eigentlich zwei parallel verlaufende Brücken…
…eigentlich zwei parallel verlaufende Brücken…
Die Brücke ist passiert, Peter setzt – bei eingeschaltetem Steuerautomaten – den neuen Kurs ab.
Dann versucht er erneut die Zollbehörde (Customs and Boarderprotection) telefonisch zu erreichen und ruft mich zum Mithören.
Am Salontisch, dem derzeit geräuschärmsten Platz im Schiff, lauschen wir gemeinsam der Ansage…
…als es kracht…
Ein Schlag dröhnt durchs Schiff und ehe wir begreifen, was das war, kracht es ein zweites Mal…
Die Inspektion zeigt Scheußliches: Lateraltonne L94 hat ein pfeilförmiges Loch in den Bug gerissen, um danach – sich schwankend drehend – ein zweites Mal (mit dem Sockel) in die Flanke der PIA zu krachen…
 Das Ungetüm! Später von Frank fotografiert…
Das Ungetüm! Später von Frank fotografiert…
Sprichwörtlich „wie vom Donner gerührt“ stehen wir da und können es nicht fassen.
Als Wut, Ärger und Zittrigkeit nachlassen, machen wir uns daran, das Loch zu verschließen. Ausstopfen mit Folie und Tüchern und Zukleben mit der amerikanischen Wunderwaffe: Duct Tape…(reichlich erprobt während unserer Camperreise zum Abkleben diverser Undichtigkeiten am Wohnmobil)
Die Folgen des derben Kusses dieses Ungetüms…

Außen…

Innen…

Außen…

Innen…
Wieso konnte das passieren? Wir zermartern das Hirn. Der eingegebene Kurs führt in deutlichem Abstand an der Stb-Seite der Tonne vorbei. Ihre BB-Seite hat uns aber Stb-seitig erwischt. Was ist da schiefgelaufen? Sind wir von einer Strömung erwischt worden? Spinnt die Navigation oder der Steuerautomat? Wir können es nicht fassen! Nicht auszudenken, wenn wir mit 6,5kn Geschwindigkeit frontal auf den stählernen Koloss gerauscht wären…
Wir haben Zeit verloren und müssen unsere Geschwindigkeit auf 8kn erhöhen, wenn wir Georgetown noch vor Dunkelheit erreichen wollen. Außerhalb des Fahrwassers – wo wegen geringerer Strömung das Vorankommen leichter ist – lauern Fallen in Form von „Crab Pots“. Das sind versenkte Krabbenkörbe, mit denen man hier die Spezialität der Region, die köstlichen Blue Crabs fängt. Kleine weiße Bojen markieren den unter ihnen befindlichen Crab Pot und sind mit selbigem über eine Leine verbunden. Eine solche Leine im Propeller würde uns zu unserem Glück gerade noch fehlen! Wachsamkeit ist gefragt. Dem GPS können wir nicht mehr vertrauen. Er fällt immer wieder aus oder springt von rechts nach links.
Mit dem Einbiegen in den Sassafras River kommt die nächste Herausforderung. Grüne und rote Tonnen – zickzackförmig ausgelegt – verlangen das ständige Kreuzen des Flusses, um die Untiefen zu umfahren. Wegen der allmählich hereinbrechenden Dunkelheit kann man die Farben nicht mehr ganz so leicht erkennen, d.h. ich versuche mittels Fernglas jeweils die nächste Tonne und Farbe zu erkennen, während Peter die flott dahin schnurrende PIA von Hand steuert.

Mit dem allerletzten Büchsenlicht fischen wir die Bojenleinen aus dem Wasser und binden die versehrte PIA an.

Sie hat jetzt erstmal wieder Pause; die Köpfe vom Skipper und siner Fru nicht…







































 mit Angelbegeisterten…
mit Angelbegeisterten…